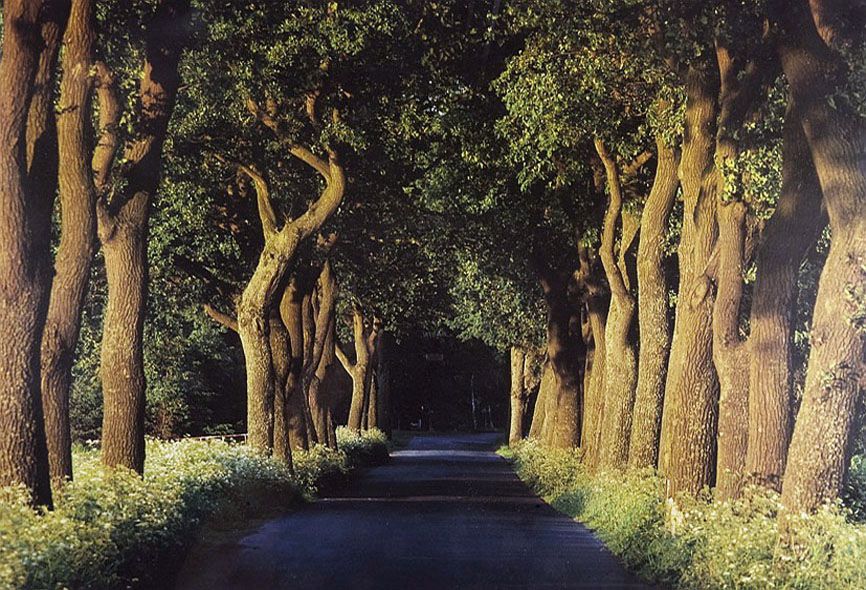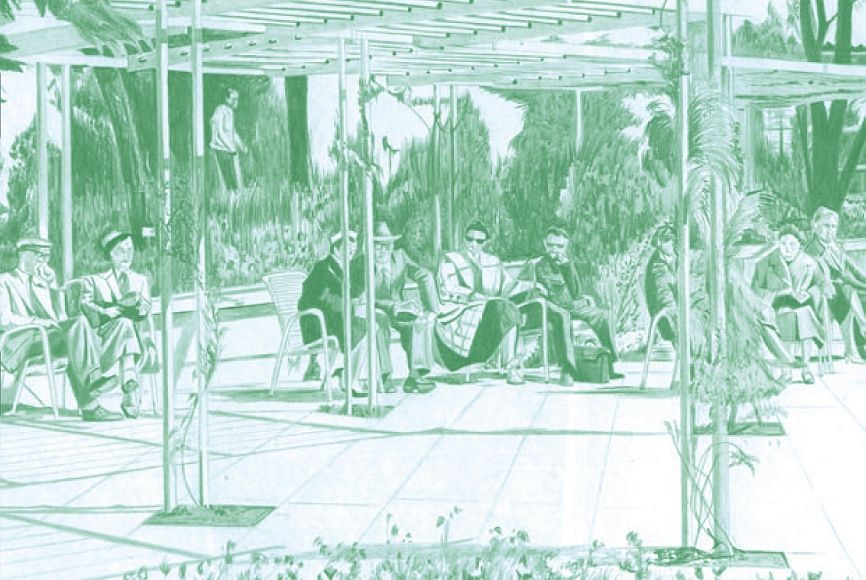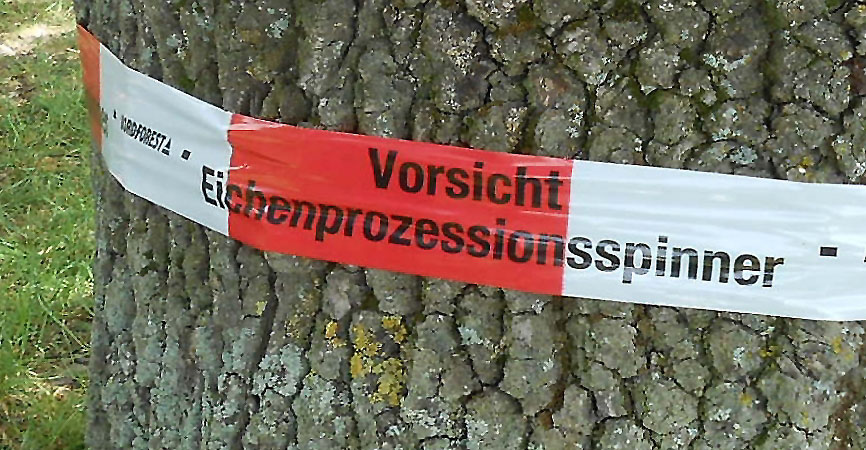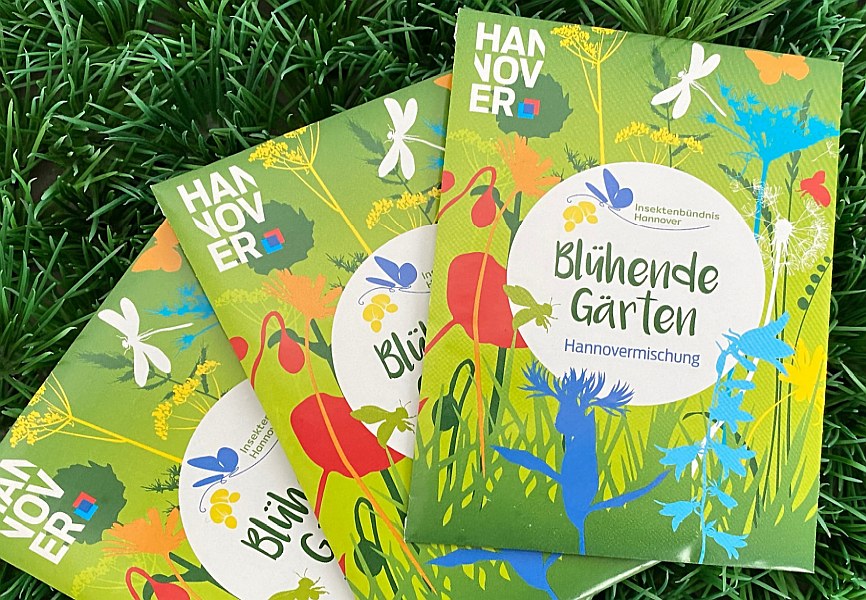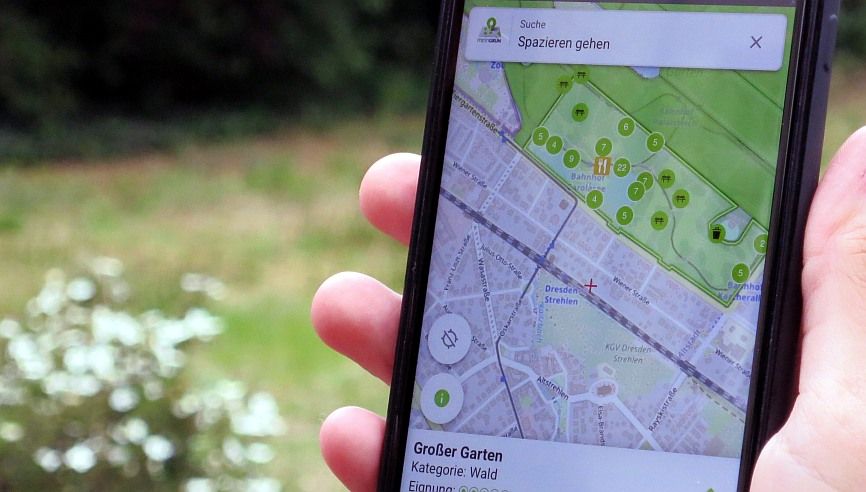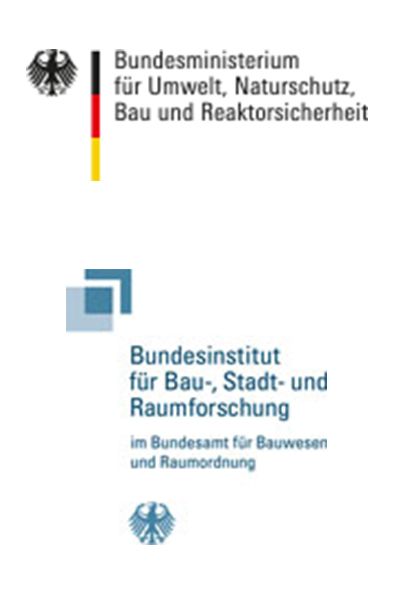
Urheber der Bilder
Auf dieser Seite werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt:
Stadt Frankfurt am Main, Grünflächenamt; Christian Reiter, Berlin; Maya Kohte, Saarbrücken; Stefan Cop, Frankfurt
Kontakt
GALK-Internetredaktion
Gerhard Doobe
Osterbekstieg 4
D-22085 Hamburg
redaktion@galk.de
GALK-Geschäftsstelle
Friedensplatz 4
D-53111 Bonn
+49 228 965010-100
geschaeftsstelle@galk.de
Landesgruppen
Arbeitskreise
Themen
Themen
IMPRESSUM | KONTAKT | DATENSCHUTZERKLÄRUNG | Galk e.V.